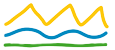Angebote für Erwachsene
Die Gedenkstätte Eckerwald ist ein authentischer Ort, an dem sich typische Erscheinungsmerkmale des nationalsozialistischen Konzentrationslager- Systems beispielhaft erkunden lassen. Dazu bietet die Initiative Eckerwald Führungen an.
Folgende Kombinationen sind möglich:
- Eine Führung durch den Gedenkpfad Eckerwald dauert etwa 1,5 Stunden.
- Der Gedenkpfad Eckerwald und der Lernort Schömberg: etwa 2,5 Stunden.
- Der Gedenkpfad Eckerwald und der KZ-Friedhof Schörzingen: 2,5 Stunden.
- Der Gedenkpfad Eckerwald, der KZ-Friedhof Schörzingen und der ehemalige Häftlingsweg zu Fuß (vier Kilometer): etwa 3 Stunden.
Die Gruppengröße ist variabel. Bei mehr als 40 Teilnehmern bilden wir zwei
Gruppen, die dann jeweils von einem Mitglied der Initiative begleitet werden.
Bei all diesen Kombinationen berechnet die Initiative pro erwachsener Person
einen Beitrag von 3,- Euro.
Sowohl der Gedenkpfad Eckerwald, als auch der Lernort Schömberg sind jederzeit frei zugänglich. Auf anschaulichen Informationstafeln kann sich der Besucher selbständig eine Vorstellung von den Geschehnissen an diesen Orten bilden.
Gut eingearbeitete Mitglieder der Initiative stehen für Vorträge und Präsentationen für Fortbildungsangebote für Lehrer und andere Berufsgruppen sowie für studentische Projekte bereit. Materialien aus unserem Archiv können leihweise zur Verfügung gestellt werden.
Für die Einarbeitung eignen sich unsere Broschüren:
- Wüste 10 – Gedenkpfad Eckerwald
- Aus schwerem Traum erwachen (Häftlingsbericht)
- Haltepunkt Eckerwald, ein Klagepsalm
Näheres zu den Broschüren fi nden Sie auf dieser Homepage unter Veröffentlichungen.
Annäherung durch literarische Versuche
 Im Eckerwald sind Reste der Schieferölproduktion erhalten, riesige Bauten aus Beton und Backstein.
Im Eckerwald sind Reste der Schieferölproduktion erhalten, riesige Bauten aus Beton und Backstein.
Bei der Gedenkstätte in Schömberg ist neben den Informationstafeln auch ein Kubus mit den Namen der 1774 KZ-Opfer zu finden.
Diese Orte hat die Initiative Eckerwald in den letzten Jahren immer wieder genutzt, um sich mit älteren Schülern über Performances dem dortigen Geschehen 1944/45 zu nähern.
Arbeitsblatt 6 stellt zwei Theater-Projekte vor, die Gerhard Lempp entwickelt und mit Schülern und Erwachsenen umgesetzt hat.
Beide Performances werden mit vollem Text im Arbeitsblatt vorgestellt, zusammen mit Bildern aus Vorführungen.
Keine passive Lektüre, sondern aktives Tun bietet diese Annäherung an die Geschehnisse im Eckerwald und in Schömberg. Durch das szenische Erleben der Texte wird ein Einblick in den Alltag der Häftlinge und in die menschenverachtende Psychologie der Täter vermittelt.
Annäherung durch Werke der Kunst – Opfer und Täter
 Auf dem Gedenkpfad Eckerwald wurden Bronzefi guren des Künstlers Siegfried Haas aufgestellt. Eine der Figuren ist die Darstellung eines KZ-Häftlings, die andere die eines SS-Mannes. Die Auseinandersetzung mit diesen Skulpturen lässt Verhaltensweisen entschlüsseln und eine Annäherung an die Gefühlslagen von Opfern und Tätern zu.
Auf dem Gedenkpfad Eckerwald wurden Bronzefi guren des Künstlers Siegfried Haas aufgestellt. Eine der Figuren ist die Darstellung eines KZ-Häftlings, die andere die eines SS-Mannes. Die Auseinandersetzung mit diesen Skulpturen lässt Verhaltensweisen entschlüsseln und eine Annäherung an die Gefühlslagen von Opfern und Tätern zu.
Arbeitsblatt 5 stellt die beiden Kunstwerke in eine Dialogposition zueinander. Jugendliche oder Erwachsene sollen versuchen, sich in die Alltagssituation im Lager hineinzudenken und die Agierenden zu Wort kommen lassen. Wie hat ein Häftling gefühlt, wie konnte er sich gegen die Allmacht der SS behaupten? Wie hat sich ein SS-Mann gefühlt, welche Handlungsmöglichkeiten hatte er, wie hat er sich wahrscheinlich verhalten? Das Arbeitsblatt kann schon in der Vorbereitung zu einem Besuch in der Gedenkstätte genutzt und ausgefüllt werden. Bei einem Besuch selbst können dann die von verschiedenen Schülerinnen und Schülern bearbeiteten Arbeitsblätter in der Gedenkstätte vor den Kunstwerken vorgestellt und diskutiert werden.
Wie wirtschaftlich war die Schieferölproduktion?
Unter normalen weltwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist das Schweröl, das durch Verschwelung aus dem Lias epsilon, dem sogenannten Ölschiefer, gewonnen werden kann, unsinnig. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges galten jedoch anscheinend andere Gesetze.
So entstand das Projekt „Wüste“: Neben drei Versuchsanlagen zur Gewinnung von Öl aus Schiefer wurde ein Großprojekt von zehn Werksanlagen („Wüste 1 – 10“) im Vorland der Schwäbischen Alb entlang der Bahnlinie Tübingen – Rottweil geplant und in Gang gesetzt.
Als „Arbeitssklaven“ wurden für dieses Projekt KZ-Häftlinge aus sieben Außenlagern des Stammlagers Natzweiler Struthof bereit gestellt.
 Arbeitsblatt 4 gibt mit Schaubildern zur geologischen Formation des Albvorlands und zu den geplanten und gebauten Produktionanlagen Hintergrundinformationen zur Schieferölproduktion.
Arbeitsblatt 4 gibt mit Schaubildern zur geologischen Formation des Albvorlands und zu den geplanten und gebauten Produktionanlagen Hintergrundinformationen zur Schieferölproduktion.
Verschiedene Dokumente zeigen, wie chaotisch der Produktionsaufbau gegen Ende des Krieges ablief. Gleichzeitig wird belegt, wie die SS vom Arbeitseinsatz der KZ-Häftlinge profitierte.
Eine Kalkulation des „Wertes eines KZ-Häftlings“ zeigt das menschenverachtende Denken der SS-Führer.
Häftlingsselbstverwaltung
 Von der NS-Lagerleitung war in den Lagern eine Häftlingsselbstverwaltung in den Wüstelagern eingerichtet worden. Sie war -hierarchisch strukturiert: An der Spitze stand der Lagerälteste, ihm unterstanden die Blockältesten und schließlich Stubenältesten. Bei der Arbeit hatten die Häftlings-Kapos das Sagen.
Von der NS-Lagerleitung war in den Lagern eine Häftlingsselbstverwaltung in den Wüstelagern eingerichtet worden. Sie war -hierarchisch strukturiert: An der Spitze stand der Lagerälteste, ihm unterstanden die Blockältesten und schließlich Stubenältesten. Bei der Arbeit hatten die Häftlings-Kapos das Sagen.
Das Verhalten der Lagerältesten beeinflusste das Leben der Häftlingen wesentlich.
Arbeitsblatt 3 zeigt am Beispiel von zwei Lagerältesten, wie sich die allgemeine Situation der Häftlinge verbessern oder entscheidend verschlechtern konnte.
Jan Albertus Cleton war Lagerältester von Erzingen. Er kam aus der niederländischen Widerstandsbewegung und zählte zu den politischen Häftlingen. Unter Einsatz seines Lebens unterstützte und organisierte er die Solidarität unter seinen Mithäftlingen.
 Walter Telschow war Lagerältester in Schörzingen und verhielt sich ganz anders. Er baute um sich ein Terrorregime auf und ging selbst mit großer Brutalität gegen Häftlinge vor.
Walter Telschow war Lagerältester in Schörzingen und verhielt sich ganz anders. Er baute um sich ein Terrorregime auf und ging selbst mit großer Brutalität gegen Häftlinge vor.
Das Arbeitsblatt zeigt, dass es selbst in den Wüstelagern Handlungsalternativen gab. Es fordert Schülerinnen und Schüler auf, positive Handlungsalternativen im eigenen Alltag zu finden.
Zwei unterschiedliche Kommandoführer
 Für die Überlebenschancen der Häftlinge war es mitentscheidend, wie die Lagerkommandanten ihre Funktion ausübten.
Für die Überlebenschancen der Häftlinge war es mitentscheidend, wie die Lagerkommandanten ihre Funktion ausübten.
An den Kommandoführern Herbert Oehler und Erwin Dold kann dies gezeigt werden.
Der 39-jährige Herbert Oehler führte das Lager Schörzingen vom Frühjahr 1944 bis Kriegsende mit großer Brutalität. Zusammen mit dem deutschen Lagerältesten Walter Günther Telschow peinigte und quälte er Häftlinge.
 Der 25-jährige Erwin Dold war zuerst Kommandoführer im Lager Haslach und kam im Februar 1945 in gleicher Funktion ins Lager Dautmergen. Nach übereinstimmenden Aussagen von Häftlingen versuchte er die schlimmsten Zustände im Lager abzumildern.
Der 25-jährige Erwin Dold war zuerst Kommandoführer im Lager Haslach und kam im Februar 1945 in gleicher Funktion ins Lager Dautmergen. Nach übereinstimmenden Aussagen von Häftlingen versuchte er die schlimmsten Zustände im Lager abzumildern.
Dadurch konnten Häftlinge die letzten Wochen bis Kriegsende überleben. Dold wurde 1947 im Kriegsverbrecherprozess in Rastatt freigesprochen.
Arbeitsblatt 2 gibt Lebensabrisse der beiden Kommandoführer. In Selbstzeugnissen und in Beschreibungen von Häftlingen werden die unterschiedlichen Charaktere deutlich.
Das Arbeitsblatt zeigt Schülerinnen und Schülern Handlungsalternativen, die auch im NS-Terrorsystem für jeden einzelnen bestanden. Mut zur Zivilcourage und persönliches Eintreten für demokratische Verhältnisse heute können diskutiert werden.