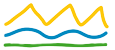Die Vernichtung der jüdischen Gemeinde
Die Zerstörung der Synagoge als jüdisches Gotteshaus
 Am 9. und 10. November 1938 wurden in ganz Deutschland die Synagogen entweder vollständig zerstört oder so beschädigt, dass sie als Gotteshäuser nicht mehr genutzt werden konnten.
Am 9. und 10. November 1938 wurden in ganz Deutschland die Synagogen entweder vollständig zerstört oder so beschädigt, dass sie als Gotteshäuser nicht mehr genutzt werden konnten.
Die Synagogen in Rexingen und Mühringen wurden angezündet. Der Brand wurde gelöscht. Der jüdische Betsaal in Horb wurde von SA und Hitler-Jugend unter Beteiligung eines Lehrers der Horber Latein- und Realschule im Innern verwüstet. Geschäfte jüdischer Kaufleute in Horb wurden demoliert. 28 jüdische Männer aus Horb und seinen Teilorten wurden ins KZ Dachau verschleppt. Als „Sühneleistung“ musste von den jüdischen Familien die „Judenvermögensabgabe“ bezahlt werden.
Arbeitsblatt 16 bringt Zeitzeugenberichte der Synagogenzerstörung in Rexingen. Auch Aussagen der Haupttäter werden zitiert. Die Synagogenzerstörungen werden als Anfang der Vernichtung der jüdischen Familien und Gemeinden deutlich. Die „Judenvermögensabgabe“ wird an einem Beispiel dokumentiert.
Die jüdischen Nachbarn werden in die Konzentrationslager verschleppt
 In drei Deportationen wurde Juden aus Rexingen in Konzentrationslager im Osten Europas verschleppt. Bei der ersten Deportation am 27. November 1941 wurden 53 Personen nach Riga in Lettland gebracht. Von diesen deportierten Menschen überlebten nur zwei, Bertha Schwarz und Sally Lemberger.
In drei Deportationen wurde Juden aus Rexingen in Konzentrationslager im Osten Europas verschleppt. Bei der ersten Deportation am 27. November 1941 wurden 53 Personen nach Riga in Lettland gebracht. Von diesen deportierten Menschen überlebten nur zwei, Bertha Schwarz und Sally Lemberger.
Am 19. April 1942 wurden 7 Personen in ein Lager bei Izbica in Polen gebracht. Dort wurden sie nach kurzer Zeit ermordet.
Am 20. August 1942 wurden über 50 Personen ins KZ Theresienstadt gebracht. Viele starben in Theresienstadt, andere wurde von dort in die Vernichtungslager Treblinka und Auschwitz verschleppt und dort ermordet. Von den nach Theresienstadt Deportierten überlebte nur Hedwig Schwarz.
Arbeitsblatt 18 behandelt, wie die Deportation nach Riga von der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) organisiert wurde. Es zeigt, wie die Finanzbehörden das Vermögen der Deportierten an sich nahm, an NS-Behörden zur Ausstattung von Dienststellen weiterleitete, bzw. das geraubte Gut öffentlich versteigern ließ. Die Themenfelder Rolle der NS-Organisationen und Instrumentalisierung jüdischer Organisationen und Profiteure der Vernichtung werden angeschnitten.
Angebot für Grundschulkinder ab Klasse 2
 Für den kompetenzorientierten und fächerübergreifenden Unterricht in der Grundschule haben Luisa Eidel, Grundschullehrerin in Horb, und Hilleke Hüttenmeister, Kunstpädagogin aus Tübingen, für den Besuch auf dem jüdischen Friedhof ein Begleitheft für Kinder entwickelt. Textgrundlage ist ein Lied, das am Sederabend in jüdischen Familien gesungen wird und auf kindgerechte Weise die jüdische Religion vorstellt.
Für den kompetenzorientierten und fächerübergreifenden Unterricht in der Grundschule haben Luisa Eidel, Grundschullehrerin in Horb, und Hilleke Hüttenmeister, Kunstpädagogin aus Tübingen, für den Besuch auf dem jüdischen Friedhof ein Begleitheft für Kinder entwickelt. Textgrundlage ist ein Lied, das am Sederabend in jüdischen Familien gesungen wird und auf kindgerechte Weise die jüdische Religion vorstellt.
Bei ihrem Besuch auf dem jüdischen Friedhof lösen die Kinder abwechslungsreiche und handlungsorientierte Aufgaben aus dem Begleitheft. Sie können sich dabei selbstständig auf dem Friedhof bewegen und die vielen geheimnisvollen Schriftzeichen und Verzierungen entdecken. Der Text liefert ihnen altersgerechte Erklärungen und vermittelt erste Eindrücke von Leben, Brauchtum und Religion jüdischer Menschen. Für die weitere Umsetzung im Unterricht sammeln die Kinder mit Hilfe der Frottagetechnik Symbole, Ornamente oder hebräische Buchstaben. So können zum Beispiel Collagen mit den Spuren des Friedhofes entstehen.
Das Begleitheft bietet vielfältige Möglichkeiten, den Besuch auf dem jüdischen Friedhof mit Grundschulkindern vor- und nachzubereiten.
Frau Eidel und Frau Hüttenmeister sind gerne bereit, Lehrerinnen und Lehrern, die einen Besuch auf dem jüdischen Friedhof in Rexingen vorbereiten wollen, zu beraten.
Das Begleitheft für Kinder kann über den Rexinger Synagogenverein bezogen werden. Einzelhefte 4,– Euro, Klassensätze ab 10 Hefte, 3,– Euro pro Heft.
Bei einem Besuch mit ihrer Grundschulklasse begleiten wir Sie gerne auf dem jüdischen Friedhof.
Beratung für Grundschulprojekte:
Luisa Eidel
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hilleke Hüttenmeister
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Angebot für Erwachsene
Für Erwachsene bietet der Rexinger Verein zeitlich abgestufte Führungen an, die normalerweise vor der Ehemaligen Synagoge beginnen.
Vor und in der Synagoge wird die Geschichte der jüdischen Gemeinde erzählt. Dabei wird das Gebäude besichtigt. Die baulichen Veränderungen seit der Nutzung der Ehemaligen Synagoge als evangelischer Kirche werden erläutert. Fotos aus dem Leben der jüdischen Gemeinde werden gezeigt.
Schwerpunkte der Führung:
- erste Zeugnisse der jüdischen Gemeinde / die Johanniter /Rexingen als Teil des Rabbinats Mühringen
- christlich-jüdisches Zusammenleben in Rexingen im 19. und 20. Jahrhundert
- Berufe jüdischer Familien im Vergleich zu christlichen Familien
- die Bedrängnis der jüdischen Gemeinde durch den NS-Staat
- die Planung und Durchführung der Gruppenauswanderung Rexinger Juden nach Palästina und die Gründung von Shavei Zion
- die Geschichte von Shavei Zion, die Beziehung der Gemeinde Rexingen und des Vereins zu Shavei Zion.
Benötigte Zeit: ca. eine Stunde.
Daran anschließend ist ein Gang auf den jüdischen Friedhof empfehlenswert. Für die Führung auf dem jüdischen Friedhof mit Wegzeit hin und zurück sollte zusätzlich eine Stunde eingeplant werden. Der Weg zum Friedhof kann auch mit dem Pkw zurückgelegt werden.
Kosten für eine Führung:
2,– Euro pro Person, bzw. ein Mindestbetrag bei Kleingruppen von 20,– Euro für die ganze Gruppe.
Gruppenauswanderung und Gründung von Shavei Zion
Die Pläne für die Auswanderung entstehen
 Nach der Verabschiedung der Nürnberger Gesetze wurde es immer dringender, Deutschland zu verlassen. Ein Teil der Rexinger Juden fasst 1937 den Entschluss, ins Land der Väter, ins britische Mandatsgebiet Palästina zu emigrieren. Ein anderer Teil wollte sich aus verschiedenen Gründen diesem Projekt nicht anschließen.
Nach der Verabschiedung der Nürnberger Gesetze wurde es immer dringender, Deutschland zu verlassen. Ein Teil der Rexinger Juden fasst 1937 den Entschluss, ins Land der Väter, ins britische Mandatsgebiet Palästina zu emigrieren. Ein anderer Teil wollte sich aus verschiedenen Gründen diesem Projekt nicht anschließen.
Arbeitsblatt 13 enthält Begriffserklärungen zu „Nürnberger Gesetze“, Kibbuz, Zionismus. Schülerinnen und Schüler sollen nachvollziehen, wie schwierig die Entscheidung war, nach Palästina zu fliehen.
1938: Die ersten Familien gründen die Siedlung Shavei Zion
 Drei Rexinger Kundschafter wählten 1937 den Boden für die Siedlung aus. Es wurde zunehmend schwieriger an Einreisezertifikate nach Palästina zu kommen. Die Siedlung musste als „Mauer-und-Turm-Siedlung“ errichtet werden, um sich gegen Angriffe aus arabischen Dörfern zu schützen. Trotz aller Anfechtungen erlebten die Gründer den ersten Tag von Shavei Zion als Befreiung.
Drei Rexinger Kundschafter wählten 1937 den Boden für die Siedlung aus. Es wurde zunehmend schwieriger an Einreisezertifikate nach Palästina zu kommen. Die Siedlung musste als „Mauer-und-Turm-Siedlung“ errichtet werden, um sich gegen Angriffe aus arabischen Dörfern zu schützen. Trotz aller Anfechtungen erlebten die Gründer den ersten Tag von Shavei Zion als Befreiung.
Arbeitsblatt 14 beschreibt die Schwierigkeiten, die Flucht aus NS-Deutschland zu organisieren und den ersten Tag von Shavei Zion.
In der neuen Heimat muss ein neues Leben erlernt werden
 Das neuen Leben in einem anderen Klima und einer bisher nicht gekannten kulturellen Umgebung stellte an alle Flüchtlingen hohe Anforderungen. Erwachsene und Kinder reagierten unterschiedlich auf diese neue Situation.
Das neuen Leben in einem anderen Klima und einer bisher nicht gekannten kulturellen Umgebung stellte an alle Flüchtlingen hohe Anforderungen. Erwachsene und Kinder reagierten unterschiedlich auf diese neue Situation.
Arbeitsblatt 15 beschreibt die Situation von Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen. Es gibt die Möglichkeit, sich in die Situation von Migrantenfamilien einzufühlen. Der Spracherwerb wird besonders thematisiert. Im Mittelpunkt steht der Zeitzeugenbericht von Esther Jacob, die 1938 von Tuttlingen im Schwarzwald als Kind nach Shavei Zion gekommen war.
Rexingen unter dem Hakenkreuz
Situation in Rexingen nach 1933
 Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Berlin veränderte sich auch in Rexingen die Situation der jüdischen Bevölkerung dramatisch. Zwei Zeitzeugen berichten, wie sie die Veränderung persönlich erlebt haben: Der jüdische Lehrer Seev Berlinger, der im Januar 1933 nach Rexingen kam und der in Rexingen geborene Hermann Gideon, der 1933 sechsundzwanzig Jahre alt war.
Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Berlin veränderte sich auch in Rexingen die Situation der jüdischen Bevölkerung dramatisch. Zwei Zeitzeugen berichten, wie sie die Veränderung persönlich erlebt haben: Der jüdische Lehrer Seev Berlinger, der im Januar 1933 nach Rexingen kam und der in Rexingen geborene Hermann Gideon, der 1933 sechsundzwanzig Jahre alt war.
Arbeitsblatt 10 behandelt die Machtergreifung der Nazis in einer Landgemeinde und beschreibt Reaktionen der jüdischen und christlichen Bevölkerung.
Gehen oder bleiben? Die Flucht aus Deutschland beginnt
 In das ehemals harmonische Zusammenleben bricht die Gewalt ein. Die Rexingen geborene Zeitzeugin Tamara Blum beschreibt die ersten Gewalttaten gegen eine jüdische Familie und deren Reaktion. Hedwig Neckarsulmer erinnert sich, wie unterschiedlich junge und alte Menschen auf die veränderte Situation reagierten.
In das ehemals harmonische Zusammenleben bricht die Gewalt ein. Die Rexingen geborene Zeitzeugin Tamara Blum beschreibt die ersten Gewalttaten gegen eine jüdische Familie und deren Reaktion. Hedwig Neckarsulmer erinnert sich, wie unterschiedlich junge und alte Menschen auf die veränderte Situation reagierten.
Arbeitsblatt 11 behandelt die Themen fliehen oder bleiben. Verwurzelung in der Heimat und Neuanfang in einem fremden Land.
Vollständige Kontrolle der jüdischen Bürger
 Fünf Dokumente aus Rexingen zeigen, wie das NS-System die vollständige Kontrolle über die jüdischen Bürger organisierte und gleichzeitig ihre Lebensmöglichkeiten immer mehr einschränkte. Sie sind in der menschenverachtenden Sprache der Nazis verfasst.
Fünf Dokumente aus Rexingen zeigen, wie das NS-System die vollständige Kontrolle über die jüdischen Bürger organisierte und gleichzeitig ihre Lebensmöglichkeiten immer mehr einschränkte. Sie sind in der menschenverachtenden Sprache der Nazis verfasst.
Arbeitsblatt 12 behandelt die Themen
alltägliche Schikane, Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung. Vorbereitung der Vernichtung.
Christlich-jüdisches Zusammenleben
Die Rolle der Johanniter zur Ansiedlung von Juden in Rexingen
 Die Entstehung der jüdischen Gemeinde rund um Horb kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass das herzogliche Württemberg sehr judenfeindlich eingestellt war – ebenso Vorderösterreich, zum dem die Stadt Horb gehörte. Daneben gab es viele kleine selbständige Territorien, die – in Abgrenzung zu Württemberg und Vorderösterreich die Niederlassun von Juden erlaubten.
Die Entstehung der jüdischen Gemeinde rund um Horb kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass das herzogliche Württemberg sehr judenfeindlich eingestellt war – ebenso Vorderösterreich, zum dem die Stadt Horb gehörte. Daneben gab es viele kleine selbständige Territorien, die – in Abgrenzung zu Württemberg und Vorderösterreich die Niederlassun von Juden erlaubten.
Arbeitsblatt 5 behandelt die Themen Judenfeindlichkeit in Württemberg. Sondersteuern für Juden. Notsituation für Juden. Rettung durch selbständige Ortsherren.
Der Kampf der jüdischen Familien um Gleichberechtigung
 Am Beispiel der Einrichtung der jüdischen Schule im 19. Jahrhundert wird gezeigt, dass die jüdische Familien ihre bürgerliche Gleichstellung nicht kampfl os erreichten.
Am Beispiel der Einrichtung der jüdischen Schule im 19. Jahrhundert wird gezeigt, dass die jüdische Familien ihre bürgerliche Gleichstellung nicht kampfl os erreichten.
Arbeitsblatt 6 behandelt die Themen Emanzipation der Juden im 19. Jahrhundert. Gleichberechtigung. Demokratische Konfliktlösungen.
Jüdische Männer im Ersten Weltkrieg / Kampf gegen Antisemitismus
 Viele jüdische Männer aus Rexingen beteiligten sich am Ersten Weltkrieg als Soldaten für Deutschland. Nationalistische Kreise versuchten in den 1920er Jahren, Juden als Drückeberger zu verleumden. Die Broschüre „Jüdische Frontsoldaten aus Württemberg und Hohenzollern“ argumentiert mit detailierten Zahlen gegen diese Verleumdung.
Viele jüdische Männer aus Rexingen beteiligten sich am Ersten Weltkrieg als Soldaten für Deutschland. Nationalistische Kreise versuchten in den 1920er Jahren, Juden als Drückeberger zu verleumden. Die Broschüre „Jüdische Frontsoldaten aus Württemberg und Hohenzollern“ argumentiert mit detailierten Zahlen gegen diese Verleumdung.
Arbeitsblatt 7 behandelt die Themen Juden als deutsche Soldaten im Krieg. Antisemitismus. Kampf gegen Antisemitismus. Vorbereitung des NS-Regimes.