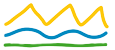Der jüdische Friedhof
Der jüdische Friedhof ist die wichtigste Einrichtung einer jüdischen Gemeinde. Meist wurden die jüdischen Friedhöfe angelegt, bevor eine Synagoge errichtet wurde, so auch in Baisingen. Der jüdische Friedhof in Baisingen wurde seit 1778 belegt und umfasst mehr als 400 Grabsteine.
Beim Betreten eines jüdischen Friedhofes sollten männliche Besucher eine Kopfbedeckung tragen. Am Schabbat (Samstag) sollte der jüdische Friedhof nicht besucht werden.
Reichhaltige Symbolik zeichnet die Grabsteine des Baisinger Friedhofs aus. Besonders häufig sind segnende Hände zu sehen. Sie geben davon Zeugnis, dass viele Gemeindemitglieder in Baisingen aus dem Priesterstamm der Kohanim stammten.
 Arbeitsblatt 11 gibt eine ausführliche Beschreibung des jüdischen Friedhofs. Es enthält einen Lageplan und drei Übersetzungen von Grabinschriften. Mit Hilfe des Arbeitsblattes kann der Friedhof selbständig erkundet werden. Dabei sollte immer die besondere Würde dieses Ortes beachtet werden.
Arbeitsblatt 11 gibt eine ausführliche Beschreibung des jüdischen Friedhofs. Es enthält einen Lageplan und drei Übersetzungen von Grabinschriften. Mit Hilfe des Arbeitsblattes kann der Friedhof selbständig erkundet werden. Dabei sollte immer die besondere Würde dieses Ortes beachtet werden.
Rundgang durch Baisingen
Mit Hilfe eines Alten Ortsplanes in der Ausstellung und einem ausgedruckten Ortsplan auf dem Arbeitsblatt 10 sind die ehemaligen Wohn- und Geschäftshäuser, die jüdische Schule, die Synagoge und der jüdische Friedhof leicht zu lokalisieren. Die meisten jüdischen Häuser lagen im Judengäßle bei der Synagoge, weitere in der Ortsmitte, hier besonders im Judenhöfle und an der Hauptstraße. Nur wenige liegen verstreut in anderen Teilen des Dorfes.
 Arbeitsblatt 10 fordert Schülerinnen und Schüler auf, mit den obigen Hilfsmitteln herauszufinden, wo die jüdischen Familien hauptsächlich wohnten.
Arbeitsblatt 10 fordert Schülerinnen und Schüler auf, mit den obigen Hilfsmitteln herauszufinden, wo die jüdischen Familien hauptsächlich wohnten.
Die Entwicklung des Anteils der jüdischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung von Baisingen kann aus der Ausstellung erarbeitet werden.
Schülerinnen und Schüler können selber einen Rundgang durch Baisingen vorschlagen und – ausgestattet mit Digitalfotoapparaten – eine Fotodokumentation der ehemaligen jüdischen Häuser erstellen.
Die Synagoge
Die Synagoge ist das religiöse Zentrum einer jüdischen Gemeinde. In Baisingen stand die kleine Landsynagoge in der Ortsmitte in der Judengasse, in enger Nachbarschaft zu mehreren Wohngebäuden. Durch ihre Renovierung in den 1990er Jahren wurde dieser authentische Ort wieder der Öffentlichkeit zugänglich.
Bei der Renovierung wurde versucht, „die ganze Geschichte sichtbar zu machen“, d.h. Spuren jeder Epoche im Gebäude zu belassen. So sind im Gebäude zum Beispiel auch Zerstörungen sichtbar geblieben, die am 10. November von Nazihorden angerichtet wurden.
 Arbeitsblatt 9 fordert Schülerinnen und Schüler auf, das Gebäude genauer zu betrachten und sich mit Hilfe des Klappbuches „Die Baisinger Synagoge“ über den Bau und seine Einrichtung zu informieren.
Arbeitsblatt 9 fordert Schülerinnen und Schüler auf, das Gebäude genauer zu betrachten und sich mit Hilfe des Klappbuches „Die Baisinger Synagoge“ über den Bau und seine Einrichtung zu informieren.
In einem Vergleich von Synagoge und Kirche oder Synagoge und Moschee können unterschiedliche Ausstattungen, Funktionen und Bedeutungen zusammen getragen werden.
Schülerinnen und Schüler können schließlich entlang von fünf Jahreszahlen eine kurze Geschichte der Baisinger Synagoge erarbeiten.
Lebensspuren Baisinger Juden
Der Titel Lebensspuren steht für Lebensläufe Baisinger Juden, die auf Tafeln und einem Infor-mationstisch in der Baisinger Ausstellung festgehalten sind. Das beigegebene Familienalbum gibt Einblicke in den Alltag der Porträtierten, aber auch in die Feier von Festen.
Arbeitsblatt 8 stellt die Aufgabe, sich mit zwei Lebenswegen von Baisinger Juden besonders zu beschäftigen.
Resi Schwarzist 1911 in Baisingen geboren und dort aufgewachsen. Ihre Eltern waren der Metzgermeister Josef Gideon, Soldat im Ersten Weltkrieg, und Sofie Gideon, geborene Schweitzer.
1932 heiratete sie Alfred Preßburger, Viehhändler aus Rexingen. 1938 floh sie mit drei Kindern nach Palästina und wurde Mitbegründerin der „schwäbischen“ Siedlung Shavei Zion, heute im Norden von Israel, wo sie und ihr erster und zweiter Mann begraben sind.
 Harry Kahn kam 1911 als Sohn von Friedrich und Clara Kahn, geborene Lassar, in Baisingen zur Welt. Sein Vater betrieb gemeinsam mit dem Onkel Max Lassar eine Viehhandlung, in die Harry Kahn eintrat.
Harry Kahn kam 1911 als Sohn von Friedrich und Clara Kahn, geborene Lassar, in Baisingen zur Welt. Sein Vater betrieb gemeinsam mit dem Onkel Max Lassar eine Viehhandlung, in die Harry Kahn eintrat.
Ende November 1941 wurde Harry Kahn mit seiner Frau, seiner Mutter und seiner Schwiegermutter nach Riga deportiert. Harry Kahn überlebte mehrere Lager und kehrte 1945 nach Baisingen zurück. Dort arbeitet er wieder als Viehhändler. Er starb 1978 und wurde auf dem jüdischen Friedhof des Ortes begraben.
Verfolgung, Deportation und Vernichtung
Am 28. November 1941 wurden 21 jüdische Frauen und Männer von Baisingen auf den Stuttgarter Killesberg verschleppt. Von dort wurden sie am 1. Dezember 1941 nach Riga in Lettland ins Konzentrationslager Jungfernhof deportiert. Von diesen 21 Personen überlebte niemand. Es folgten 1942 weitere Deportationen nach Izbica bei Lublin und nach Theresienstadt. Nur der in Baisingen geborene und aufgewachsene Harry Kahn, von Beruf Viehhändler, der mit seiner ersten Frau Irene von Haigerloch aus deportiert wurde, kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg nach Baisingen zurück und gründet dort wieder eine Viehhandlung.
 Arbeitsblatt 7 fordert Schülerinnen und Schüler auf, sich mit verschiedenen Quellen zu beschäftigen.
Arbeitsblatt 7 fordert Schülerinnen und Schüler auf, sich mit verschiedenen Quellen zu beschäftigen.
In der Ausstellung gibt es Erinnerungstexte an die Deportierten. In der Broschüre „Jüdisches Baisingen“ werden die Lebenshintergründe von vier Deportierten geschildert.
In der Gedenkstätten-Rundschau Nr. 7 vom November 2011 werden alle am 28. November 1941 von Baisingen deportierten Menschen mit Kurzbiografien aufgeführt.
Eine besondere Aufgabenstellung soll es den Schülern ermöglichen, sich mit dem Ablauf der Deportation im April 1942 nach Izbica intensiver zu beschäftigen.
Von der Blüte der jüdischen Gemeinde bis zu ihrer Bedrohung
Anpassungen der jüdischen Familien an die christliche Mehrheitsgesellschaft
 Die zunehmende Verwendung der deutschen Sprache nicht nur als Umgangssprache sondern auch als Schriftsprache im 19. Jahrhundert zeigt, wie sich die jüdischen Familien der christlichen Mehrheitsgesellschaft in vielen Bereichen anglichen. Sogar auf den Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof treten vermehrt deutsche Inschriften auf. Neben den gesetzlich verordneten deutschen Familiennamen werden auch typisch „deutsche“ Vornamen jüdischen Kindern gegeben.
Die zunehmende Verwendung der deutschen Sprache nicht nur als Umgangssprache sondern auch als Schriftsprache im 19. Jahrhundert zeigt, wie sich die jüdischen Familien der christlichen Mehrheitsgesellschaft in vielen Bereichen anglichen. Sogar auf den Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof treten vermehrt deutsche Inschriften auf. Neben den gesetzlich verordneten deutschen Familiennamen werden auch typisch „deutsche“ Vornamen jüdischen Kindern gegeben.
Arbeitsblatt 4 schickt Schülerinnen und Schüler in der Ausstellung in der Baisinger Syngoge auf Spurensuche, wo sich die deutsche Schrift und „deutsche“ Namen finden lassen. Sogar die Megillat Baisingen, die über die Pogrome von 1948 erzählt, ist auf deutsch verfasst, wenn sie auch in hebräischen Buchstaben geschrieben wurde.
Die jüdische Schule in Baisingen
 Ab 1836 regelte ein neues Gesetz für Volksschulen in Württemberg den Unterricht jüdischer Kinder neu. Wenn eine jüdische Gemeinde mehr als 60 Familien umfasste, konnte sie eine staatlich finanzierte Konfessionsschule einrichten lassen. Lag die Zahl der Familien darunter – wie in Baisingen – konnte die jüdische Gemeinde eine freiwillige Konfessionsschule auf eigene Kosten führen, die aber auch staatlich kontrolliert wurde.
Ab 1836 regelte ein neues Gesetz für Volksschulen in Württemberg den Unterricht jüdischer Kinder neu. Wenn eine jüdische Gemeinde mehr als 60 Familien umfasste, konnte sie eine staatlich finanzierte Konfessionsschule einrichten lassen. Lag die Zahl der Familien darunter – wie in Baisingen – konnte die jüdische Gemeinde eine freiwillige Konfessionsschule auf eigene Kosten führen, die aber auch staatlich kontrolliert wurde.
Arbeitsblatt 5 fordert dazu auf, die Schulverhältnisse in jüdischen Gemeinden am Beispiel Baisingen vor dem neuen Volksschulgesetz und nach dessen Einführung zu vergleichen. Schülerinnen und Schüler können sich mit der Bedeutung der „allgemeinen Schulpflicht“ für moderne Gesellschaften beschäftigen. Auch das Recht auf besondere Bildungsinhalte von Minderheiten kann angesprochen werden.
Das Zusammenleben von Christen und Juden im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert
 Die Ausstellung in der Synagoge in Baisingen gibt viele Hinweise über das Verhältnis von Christen und Juden im Dorf.
Die Ausstellung in der Synagoge in Baisingen gibt viele Hinweise über das Verhältnis von Christen und Juden im Dorf.
Arbeitsblatt 6 stellt die Aufgabe, in der Ausstellung Beispiele zu suchen, wie die Christen und Juden in Baisingen miteinander umgegangen sind.
Es fordert Schülerinnen und Schüler auch auf, eigene Einschätzungen/Bewertungen abzugeben, inwiefern die Ausstellung in der Synagogen ausreicht, antisemitische Entwicklungen in der Gesellschaft bis 1933 bzw. 1945 zu erklären. Diese Fragestellung kann auch anregen, zusätzliche Informationsquellen, z.B. das Buch „Nationalsozialismus im Landkreis Tübingen. Eine Heimatkunde“ für weitere Forschungen heranzuziehen.